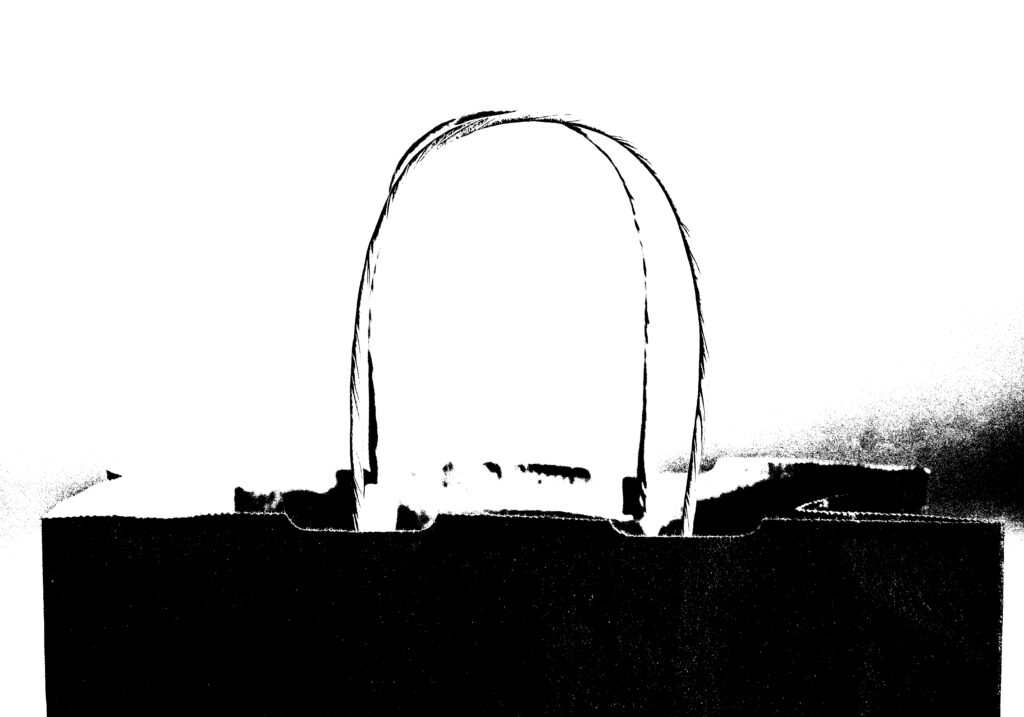
Ein Kommentar von Knut
Die tuuwi ist keine homogene Gruppe, deshalb sind wir auch nicht immer einer Meinung. Das ist auch gut so, denn wo keine Kontroverse ist, da kann sich auch kein kritisches Bewusstsein entwickeln. Nach außen hin kann allerdings schnell der Eindruck entstehen, dass die ganze tuuwi sich mit den Texten auf unserem Blog positioniert. Wäre dem so, dann gäbe es sehr wenige Blogartikel von uns, denn erfahrungsgemäß bahnt sich überall dort, wo die tuuwi als Hochschulgruppe Stellung beziehen soll, eine weitere Grundsatzdebatte an. Am 19. April wurde ein Artikel über die App „Too good to go“ veröffentlicht, auf den ich im Folgenden eingehen möchte.
Die App „Too good to go“ richtet sich vermeintlich gegen die immense Lebensmittelverschwendung auf diesem Planeten und das sicherlich auch aus einer ethisch nachvollziehbaren Intention heraus. Der Grundgedanke: Auf das individuelle Verhalten Engagierter statt auf langwierige politische Lösungen setzen. Wirtschaftliche Anreize für Unternehmen schaffen, um grüner zu werden, ohne tatsächlich etwas an ihren Produktionsketten verändern zu müssen. Dass auf diese Weise nur Symptome bekämpft werden, statt die Ursachen der Lebensmittelverschwendung anzugehen, dürfte offensichtlich sein.
Lebensmittelverschwendung ist ein „natürliches“ (soll heißen: systemimmanentes) Resultat kapitalistischer Produktionsweisen. Denn in einem Wirtschaftssystem, in dem Konkurrenz das treibende Prinzip ist, muss überproduziert werden, um niedrige Preise zu garantieren und somit wettbewerbsfähig zu bleiben. Das bedeutet aber auch, dass Lebensmittelverschwendung (zumindest in diesem Ausmaß) nicht bei einem gleichzeitigen Aufrechterhalt kapitalistischer Produktionsweisen beendet werden kann. Der Nebensatz, „dass Profit und Nachhaltigkeit zeitgleich möglich sind“, ist also mehr als irreführend. Nachhaltig kann nur dort gewirtschaftet werden, wo nicht Profit, sondern soziale und ökologische Verantwortung die oberste Maxime ist.
Drei Dinge sind hier zu problematisieren: Erstens verdienen die Unternehmen, die bei „Too good to go“ mitmachen, durch den Weiterverkauf von Lebensmitteln, die eigentlich nie hätten produziert werden dürfen, zusätzlich Geld. Die App steht also ganz im Zeichen der Profitmaximierung.
Zweitens werden durch diese Art der Symptombekämpfung die realen Ursachen der Lebensmittelverschwendung verschleiert. Es besteht weiterhin noch weniger Anlass, an diesen Ursachen etwas zu ändern, da die Folgen durch die kontinuierlichen Bemühungen der App-Nutzer*innen abgefangen werden. Sie werden zum festen Bestandteil der Wertschöpfungskette und die Lebensmittelkonzerne können sich darauf verlassen, dass jemand ehrenamtlich hinter ihnen aufräumt.
Drittens nutzen Unternehmen das Engagement der App-Nutzer*innen aus, um sich selbst einen grüneren Anstrich zu verleihen (was wiederum den Zweck hat, ihnen einen Marktvorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen). Dieser Punkt wurde im letzten Absatz des „Too good to go“-Artikels ganz richtig erkannt und sogleich rhetorisch aus dem Ring geschlagen. Auf die Frage „Aber sollte man es nicht auch mal von der anderen Seite betrachten?!“ sei erwidert: „Nein! Genau von dieser Seite möchte ich das Thema betrachtet wissen!“ Denn ich schreibe Artikel, um Missstände zu kritisieren, und nicht, um ihnen auf Zwang ein Gutes abzugewinnen (auch diesen Optimismus möchte ich als aus einer langen neoliberalen Denktradition stammend verstanden wissen). Wenn die hier marginalisierten „schwarzen Schafe“ (also ethisch fragwürdige Großkonzerne) überproportional viele Lebensmittel verschwenden, dann kann die Lösung nicht darin liegen, gerade ihnen durch finanzielle Anreize noch nahe zu legen, an ihrer Überproduktion festzuhalten und dabei Greenwashing zu betreiben, um sich damit noch stärker vor kleineren Unternehmen zu profilieren, welche nicht die finanziellen Mittel für große Werbekampagnen haben.
Am Ende des Tages kommt es nicht darauf an, überhaupt Lebensmittel gerettet zu haben, sondern ob sich an den Produktionsbedingungen selbst etwas geändert hat. Der abschließende Verweis auf die freie Wahl der App-Nutzer*innen bei ihren Käufen greift ebenfalls nur ein kapitalistisches Narrativ auf, laut welchem die Marktmacht bei den Verbraucher*innen liege, quasi als demokratisches Instrument der Steuerung durch individuelle Kaufentscheidungen. Wenn sich nun aber alle entschließen, bei bestimmten Unternehmen nichts abzuholen, was ändert das dann am Ende des besagten Tages?
Was also tun? Welche Alternativen gibt es? Genau wie „To good to go“ bekämpft auch „Foodsharing“ nur die Symptome der Lebensmittelüberproduktion, zumindest aber unter Verzicht auf Kommerzialisierung, da die Abholungen dort komplett kostenlos sind. Wer Lebensmittel aus nachhaltigem und regionalem Anbau konsumieren und somit alternative Produktionsweisen stärken möchte, kann sind an die Gemeinschaftsgärten, die Marktschwärmer oder die Solidarische Landwirtschaft wenden. Auf diesem Weg wird zwar die Lebensmittelüberproduktion globaler Unternehmen ebenfalls nicht bekämpft, mittel- und langfristig jedoch sind sie notwendig, um alternative Versorgungsstrukturen neben der vermeintlich alternativlosen zu etablieren. Ein kurzfristiger Wandel aber kann nur auf politischem Weg erfolgen und um diesen einschlagen zu können, müssen wir uns vom Märchen eines grünen Kapitalismus verabschieden.

