
Weiterlesen Hoffnung in Dresden und Chaos in der Welt – ein Kommentar

Weiterlesen Hoffnung in Dresden und Chaos in der Welt – ein Kommentar
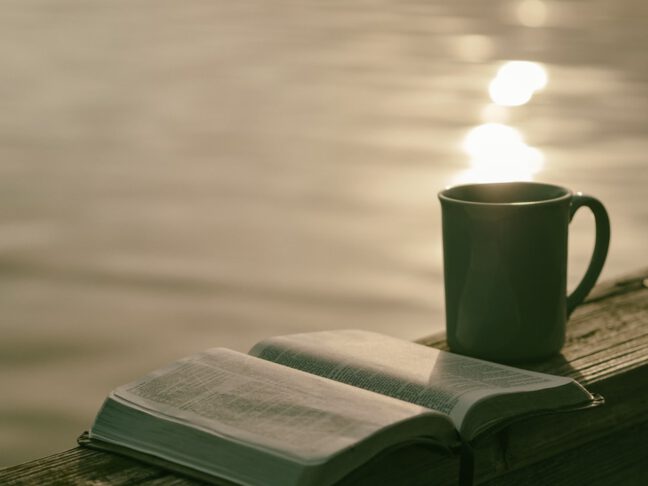
Von Luisa Zenker
Autofreie Innenstädte, eine Wirtschaft im Kreislauf – ohne Wachstum – , klimaneutral erzeugte Energie, eine sozialgerechte Gesellschaft mit geringen Einkommensunterschieden und hohen Teilhabemöglichkeiten – was heutzutage viele soziale Bewegungen umtreibt, sind eigentlich keine neuen Gedanken. Schon 1975 veröffentlichte Ernest Callenbach eine literarische Utopie, in welcher verschiedene alternative Lebensmodelle versammelt. Ökotopia heißt das kleine Buch – nach den beiden griechischen Wörtern Oikos (=Zuhause) und Topos (=Ort) benannt. Ernest Callenbach versucht so einen Ort zu beschreiben, wo sich vielleicht viele von uns tatsächlich zuhause fühlen könnten. Der Autor, zu der Zeit ein unbekannter Literaturwissenschaftler, trug mit seinem Buch maßgeblich zur Entstehung und Ausbreitung der Umweltbewegung bei. Selbst Steve Jobs bezeichnete Ökotopia als eine Bibel seiner Generation. Weiterlesen Kleine Urlaubslektüre für die Sommerpause: Ökotopia

Von Luisa Zenker
Es war im Herbst letzten Jahres, als Student*innen der TU Dresden den größten Hörsaal der Universität besetzten. Sie wollten nicht länger warten und zusehen, wie die TU Dresden weiterhin…. Sie forderten effektiven Klimaschutz an der Uni.
Einige Wissenschaftler*innen schauten skeptisch, aber auch neugierig auf die Aktion. Einige wollten selbst Teil dessen sein, andere kritisierten sie dafür: Die Wissenschaft sei der Neutralität verpflichtet, hieß es dann. Doch wie weit geht diese Neutralität, was heißt das überhaupt, neutral sein? Und darf Wissenschaft aktivistisch sein? Dieser Beitrag versucht ein paar Gedanken zu sortieren. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit – er will nur Impulse setzen, für neue oder alte Gedanken.
Bevor die Debatte beginnt, sollten wir eine kleine Zeitreise unternehmen. Eine Reise entlang von Geschichten, die aktivistische Wissenschaftler*innen zu erzählen begannen, denn wie wir später herausfinden werden, sind Geschichten unabdingbar mit einer aktivistischen Wissenschaft verknüpft. Weiterlesen Darf Wissenschaft aktivistisch sein? Und wenn ja, wie viel?
